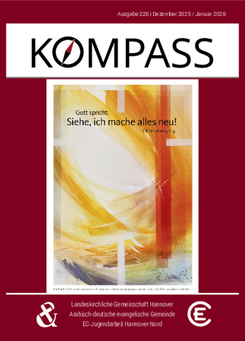Interview mit Präses Dr. Michael Diener
Ich treffe Dr. Michael Diener in den Räumen unserer Gemeinde. In einer Stunde beginnt der arabisch-deutsche Gottesdienst, in dem Diener seinen zweiten von drei Vorträgen halten wird. Das Haus ist schon gut gefüllt und draußen ist es wieder herrlich sommerlich. Noch schnell ein Foto geschossen und dann gleich zur ersten Frage – einen so wichtigen Mann lässt man nicht warten.
Herr Diener, wieso nennt man Sie Präses und nicht Vorsitzenden oder Präsidenten?
War schon vorher so, habe ich mir nicht rausgesucht. Irgendwann hat sich dieser Präses-Titel – was ja auch einfach nur Vorsitzender heißt – eingespielt. Mir persönlich ist meine Bezeichnung nicht so wichtig, es gibt aber immer kleine, lustige Geschichten. Beispielsweise, wenn jemand kommt und sagt: „Heut‘ kommt unser Präsens“, und ich dann sage: „Ja, ich bin jetzt sehr gegenwärtig“.
Okay, ja dann ist aber doch die Knackfrage, warum Ihr Stellvertreter „Stellvertretender Vorsitzender“ und nicht „Stellvertretender Präses“ heißt!
Ja! Das ist, glaube ich, einfach nicht richtig durchdacht, wobei wir schon auch vom „stellvertretenden Präses“ sprechen.
Eine Frage, die mich sehr beschäftigt: Sind für uns als LKGs Gemeindevisionen wichtig? Konkret formulierte und gelebte Gemeindevisionen!
Meine Antwort ist ein klares Ja. Ich akzeptiere und respektiere, dass wir in der Weite Gnadaus die Verbindung zur Landeskirche unterschiedlich leben, und ich weiß, dass es sehr lebendige, fruchtbare Modelle gibt, wo die Gemeinschaft sich als Teil der Kirchengemeinde versteht, aber in der Tendenz muss man sagen, dass das sogenannte Modell 1 (LKG, zur Kirchengemeinde) immer weniger werden wird und das Modell 2 (der partiell-stellvertretende Dienst) immer mehr werden wird.
Die Vision?
Die Vision ist ganz klar die, dass wir lernen müssen, dass Menschen in der Regel an einem Ort beheimatet sein möchten. Also dieser Doppelgang, gleichzeitig die Kirchengemeinde und die Gemeinschaft, das als eine Vertiefung des Glaubens zu verstehen, funktioniert an ganz vielen Stellen nicht. Man kann es nachweisen, dass wir gerade in den 1960er bis 1980er Jahren ganz, ganz viele Leute „abgegeben“ haben an die freien evangelischen Gemeinden.
Aufgrund dieser Dopplung, die viele nicht leisten konnten?
Naja, die sie nicht leisten konnten aber auch nicht leisten wollten. Sie haben nicht verstanden, weshalb sie bei einer Taufe zu einem Pfarrer gehen sollten, den sie ihr Leben lang noch nie gesehen haben.
Hätten wir diesen Wandel dann früher vollziehen müssen?
In meinen Augen hätten wir ihn früher vollziehen müssen. Es gibt lokale Situationen, wo es gut ist, es nicht zu tun. Ich kenne große Gemeinschaften als Modell-1-Gemeinschaften, von denen ich sagen würde, die leben das genau richtig, da passt das. Aber in der Fläche insgesamt gesprochen hätten wir da früher mit anfangen müssen. Das ging nicht, weil teilweise die Kämpfe in der Gemeinschaft zu groß waren. Es gab ja viele Gemeinschaftsleute, die so treu in der Kirche waren, dass sie nicht wollten, dass die Gemeinschaft zum Parallelprogramm wird. Es ging aber auch nicht, weil uns die Kirche oft diese Freiheiten gar nicht gegeben hat.
Bei uns wären es vielleicht zwei Prozent, die morgens noch in einen Gottesdienst gehen.
Dann liegt ihr gut im Schnitt. In der Regel lässt sich die Verbundenheit zwischen Gemeinschaft und Kirche nicht mehr durch einen gleichzeitigen Besuch herstellen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir sonst die enge Verbundenheit, die ich absolut will, miteinander leben können. In Hannover gibt es so viele Kirchengemeinden. Kein Glied einer evangelischen Kirchengemeinde macht sich Gedanken darüber, dass es die Leute in der anderen Kirchengemeinde nicht kennt. Man sieht sich bei Dekanats- und Bezirksfesten und sonst bekennt man im Rahmen des evangelischen Glaubens seine eigene Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde. Und ich finde, dass es Zeit ist, dass wir an vielen Orten auch personalgemeindliche Strukturen ausbilden und jeder, der bei uns reinkommt, weiß, er betritt Boden der Evangelischen Kirche in Gestalt des freien Werkes. [Anm.: Unter einer „Personalgemeinde“ versteht man eine Kirchengemeinde, die sich nicht aus einem bestimmten Gebiet sondern aus überörtlich zusammenfindenden Mitgliedern zusammensetzt.] Und das wird die Kirche in der Zukunft noch bitter nötig haben, dass wir das auch tun. Das Verbindende ist übrigens auch, dass wir gemeinsam auf dem Boden von Verfassung und Bekenntnis und Gesetzen der Landeskirche stehen. Wir haben kein eigenes Bekenntnis! Von daher sind wir ein ganz, ganz essentieller Teil der Kirche. Und wenn die Kirche nicht erkennt, dass sie neben Ihrer parochialen Arbeit – die ich extrem wichtig finde – auch die Gestalt der Freien Werke braucht, dann macht sie sich selber arm. [Anm.: Parochiale Gemeinden sind Gemeinden, deren Mitglieder aufgrund ihres Wohnortes der Gemeinde zugeordnet sind.] Und ich bin froh, dass das Kirche immer mehr merkt, dass es diese anderen Formen geben muss.
Das Thema Homosexualität ist in der Christenheit meiner Ansicht nach ein völlig überbetontes. Der Bibel ist das weitestgehend egal und auch im Gemeindealltag hatte ich höchstens mal indirekt mit diesem Thema zu tun. Die inhaltliche Diskussion ist mir deshalb in diesem Interview auch nicht wichtig. Ich möchte etwas anderes mit Ihnen klären. Sie standen, nachdem 2015 ein Interview mit Ihnen in der Zeitschrift Die Welt veröffentlicht wurde, stark in der Kritik. Damals sagten Sie: „Als Pfarrer habe ich gelernt, anzuerkennen, dass Menschen bei dieser Frage (nämlich der Homosexualität) die Bibel anders lesen. Diese Brüder und Schwestern sind mir genauso wichtig wie diejenigen, die meine Meinung teilen.“ Und das gelte auch „für Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben und sich von Gott nicht zur Aufgabe dieser Prägung aufgefordert sehen“. Diese Aussagen ließen die Wellen in der evangelikalen Szene hochgehen. Ulrich Parzany (ProChrist) wendete sich in einem öffentlichen Brief gegen Sie und stellte eine „Gegenbewegung“ zum Gnadauer Verband zur Disposition. Was ist seit damals entstanden oder dauerhaft kaputt gegangen?
Naja, Ulrich Parzany und ich gehören ja zur selben Gemeinde. Wir gehen beide in den Friedenshof in Kassel, eine LKG, die Profilgemeinde innerhalb der Landeskirche ist (genau wie oben beschrieben). Wir sehen uns dort nur selten, weil wir beide beruflich viel unterwegs sind. Wir haben damals diese Frage miteinander geklärt. Wir haben am Silvesterabend 2015 miteinander Abendmahl gefeiert. Das war mir sehr wichtig. Es steht persönlich nichts zwischen uns. Ich weiß, dass das, was er getan hat, seinem Gehorsam gegenüber dem Evangelium entspricht, und ich habe getan, was meinem Gehorsam gegenüber dem Evangelium entspricht. Und wenn man sagen will, was dabei herum gekommen ist, dann hat dieser Streit eine Positionierung ausgelöst, von Verbänden und von Werken in der frommen Welt zum Thema Homosexualität. Wir haben dann im Februar 2016 in der Gnadauer Mitgliederversammlung eine Erklärung zur Homosexualität verfasst, die im Grunde „konservativ-klassisch“ ist und mit diesem merkwürdigen Kunstwort, das die Frommen so gerne gebrauchen, „praktizierte Homosexualität“ ablehnt, aber wir haben ganz bewusst einen Satz hineingeschrieben, der sagt, dass etliche unter uns das anders sehen und die Bibelstellen anders auslegen und dass wir das gemeinsam tragen wollen. Das heißt, wir haben im Gnadauer Verband eine Öffnung in der Frage der Homosexualität erreicht. Nichts anderes wollte ich eigentlich. Ich wollte ja nicht, dass die klassisch-konservative Meinung einfach verschwindet – das wäre auch im Blick auf die Weltkirche nicht angemessen. Aber ich wollte, dass wir uns in dieser Frage öffnen. Das haben wir in „Gnadau“ und übrigens auch in der Deutschen Evangelischen Allianz getan. Und seitdem sind Werke und Verbände in Gnadau herausgefordert, sich zu dieser Frage zu positionieren. Wenn sie es müssen, tun sie es in der Regel immer noch klassisch-konservativ. Es gibt aber auch andere Stimmen dazu, sodass etwas in Bewegung gekommen ist. Die Tendenz zeigt, dass die Zahl derer, die diese Frage nicht zu einem Trennungsgrund machen werden, immer größer wird und wächst, und von daher hat sich in meinen Augen der Konflikt auch gelohnt; so schwierig er auch war.
Wenn sie einen jungen Christen, den sie etwas besser kannten, zum letzten Mal sehen würden, was würden sie ihm final mit auf den Weg geben?
Also einem jungen Christen? (überlegt) Vertraue darauf, dass dein Leben in Gott Wurzeln und Flügel hat und gehe, im Hören auf Gottes Wort und in der Gemeinschaft der Christen, deinen Weg.
Ich danke Ihnen für das informative und persönliche Gespräch.
Sehr gerne.
Das Interview führte Friedrich Neupert